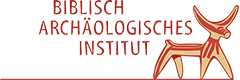Holger Siegel: Die Modelle Conrad Schicks sowie eine dreidimensionale Analyse zu seinen späten Zeichnungen der Grabeskirche und ihrer Umgebung. Die Modelle Conrad Schicks zu biblischen Vorbildern (Stiftshütte), zu Jerusalemer Bauwerken, zum ehemaligen Tempel- bzw. dem Grabeskirchenkomplex sowie zur Altstadt Jerusalems insgesamt sind seit ihrer Erschaffung weltbekannt. Eine Promotion, die sich mit diesen Werken und deren wissenschaftlichen Gehalt auseinandersetzt, war längst überfällig. Es darf Holger Siegel als großes Verdienst angerechnet werden, dass er sich dieser Aufgabe gestellt hat. Seine architektonische Expertise kommt ihm bei dieser Arbeit deutlich zugute.

Patrick Leiverkus: „Digitalisierung in der Biblischen Archäologie. Dargestellt am Beispiel der Projekte des Biblisch-Archäologischen Instituts Wuppertal und des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes“. Diese Arbeit entstand aus einer langen Mitarbeit des Promovenden mit dem BAI Wuppertal und dem DEI Jerusalem/Amman. Deren Ausgrabungs- und Surveyprojekte stehen folglich im Mittelpunkt (Tall Zirāʿa 2003–2013, Zionsberg in Jerusalem 2015–2024 und Tiberias 2021–2024 sowie der Survey im Wādī al-ʿArab 2010-2014). In dieser Promotionsschrift nicht um simple Vermessungsaufgaben oder die Abwicklung längst vertrauter Formen technisch-digitaler Dokumentationen – sondern um einen ganzheitlichen Ansatz: die Bewältigung der digitalen Herausforderung in der Archäologie. Dieser Weg wird am besten mit der Formel „Von der Skizze, der Befundbeschreibung und dem Zettelkasten hin zur papierlosen Grabung“ beschrieben.

Jennifer Zimni-Gitler: „Urbanism in Jerusalem from the Iron Age to the Medieval Period at the Example of the DEI Excavations in Mount Zion”. Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Besiedlungsgeschichte der Stadt Jerusalem. Sie nutzt für ihre Beschreibung exemplarisch und programmatisch Erkenntnisse aus erster Hand: die Befunde der Ausgrabungen des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes (DEI) in den Jahren 2015 bis 2020 auf dem Zionsberg. Die Lage der Ausgrabungsareale (im ehemaligen Südwesten der vermutlich im 8. Jh. v. Chr. erweiterten historischen Stadt Jerusalem) ist für dieses Vorhaben günstig, denn spätestens seit dem 12. Jh. lag dieser Bereich extra muros – wurde also außerhalb des Gipfelbereiches um die Hagia Sion nicht modern überbaut.

Katja Soennecken: Die Arbeit Kulturelle Umbrüche in der südlichen Levante. Der Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit unter besonderer Berücksichtigung des Tall Ziraa beschäftigt sich mit den spätbronzezeitlichen sowie eisenzeitlichen Strata der Ausgrabung auf dem Tall Ziraa in Nordjordanien. Die Übergangszeit von der Späten Bronzezeit zur Eisenzeit war eine von großen Umbrüchen geprägte Zeit. Der durch alle Epochen kontinuierlich besiedelte Tall Ziraa hat aufgrund seiner Lage an einer Handelsstraße nicht nur eine politische Bedeutung, sondern auch einen großen Reichtum an materiellen Hinterlassenschaften aufzuweisen und bietet einen idealen Ausgangspunkt, um dieser Fragestellung nachzugehen. Neben einer historischen Darstellung der entsprechenden Zeiten und der Besprechung des Ortes selbst findet eine vergleichende Einordnung in den kulturellen Großraum der südlichen Levante anhand anderer Fundplätze statt. Da dieses Thema in den Kernbereich der Biblischen Archäologie führt, findet eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung der archäologischen Erkenntnisse für die Theologie bzw. für die theologische Interpretation der Geschichte Israels statt.
Volltext online: http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DocumentServlet?id=7401
Die Disputatio fand am 27. Juli 2017 in den Räumen der Bergischen Universität Wuppertal statt. Doktorväter: Prof. Dr. Armin Eich (Erstgutachter) und Dr. Jutta Häser (Zweitgutachterin) Prüfungskommission: neben den beiden Genannten Prof. Dr. Wolfgang Orth und Prof. Dr. Peter Mommer.
Dr. Katja Soennecken arbeitet seit 2009 am Gadara Region Project mit. Sie verfasst als Autorin Band 3 und 4 und als Co-Autorin Band 8 der Grabungsendpublikation.

Andrea Schwermer: Die Kochtopfkeramik des Tall Zirā‛a. Eine typologische und funktionale Analyse der Funde von der Frühen Bronze- bis in die späte Eisenzeit. Kochtöpfe genügen im Vergleich zu anderen Gefäßarten nicht unbedingt ästhetischen Ansprüchen, aber ihre Betrachtung lohnt aufgrund der hohen technischen Anforderungen an Material und Herstellung, und nicht zuletzt geben Kochtöpfe einen Einblick in einen der wichtigsten Bereiche menschlichen Alltagslebens. Die unmittelbar aus dem Fundmaterial heraus entwickelte Untersuchung nimmt in ihrem Hauptkapitel eine Typologisierung der Kochtöpfe vor und ordnet diese anhand von statistischen Analysen und ausführlichen Vergleichen mit den Funden ausgewählter Grabungsorte östlich und westlich des Jordan chronologisch ein. Dabei werden auch die in der Literatur meist vernachlässigten Backplatten eingehend betrachtet. Weitere Kapitel widmen sich dem Material, dem Herstellungsprozess und dem Gebrauch der Kochtöpfe sowie ihrem Vorkommen in ausgewählten Gebäuden unterschiedlicher Bestimmungen und Epochen. Volltext online: http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/edocs/dokumente/fba/geschichte/diss2014/schwermer Die Disputatio fand am 22. Januar 2015 in den Räumen des BAI in Wuppertal statt. Doktorväter: Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Dieter Vieweger (Erstgutachter) und Prof. Dr. Wolfgang Orth (Zweitgutachter) Prüfungskommission: neben den beiden Genannten Prof. Dr. Armin Eich, Prof. Dr. Volker Remmert, Dr. Jutta Häser.
Dr. Andrea Schwermer arbeitet seit 2004 am Gadara Region Project mit. Sie verfasst als Co-Autorin die Keramik-spezifischen Artikel der Bände 2-4 für die Grabungsendpublikation.

Frauke Kenkel: Untersuchungen zur hellenistischen, römischen und byzantinischen Keramik des Tall Zira’a im Wadi al-‚Arab (Nordjordanien) – Handelsobjekte und Alltagsgegenstände einer ländlichen Siedlung im Einflussgebiet der Dekapolisstädte. Die Arbeit untersucht die keramischen Hinterlassenschaften des Tall Zira’a vom 3. Jh. v. Chr. bis ins 7. Jh. n. Chr. Dabei wurden sowohl die vielen verschiedenen Warenarten als auch die unterschiedlichen Keramikgattungen berücksichtigt. So konnte für das gesamte Material eine Typologie aufgestellt werden, anhand derer kulturhistorische Aussagen getroffen werden konnten. Die Untersuchung zeigt deutlich, dass der Tall Zira’a in dieser Zeitspanne nicht nur eine einfache, dörfliche Siedlung im Hinterland der Dekapolisstadt Gadara war, sondern eine wichtige Funktion im Wadi al-‚Arab einnahm. Volltext online: URI: kups.ub.uni-koeln.de/4977/ Doktorväter: Prof. Dr. H. von Hesberg (1. Gutachter), Prof. Dr. Th. Fischer (2. Gutachter). Die Disputation fand am 11.07.2012 im Archäologischen Institut der Albertus Magnus Universität zu Köln statt. Den Prüfungsausschuss bildeten: Prof. Dr. W. Pape als Vertreter der Dekanin, Prof. Dr. H. von Hesberg, Prof. Dr. Th. Fischer, Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. D. Vieweger und PD Dr. E. Thomas.
Dr. Frauke Kenkel arbeitete seit 2008 am Gadara Region Project mit. Sie war von 2013 bis 2016 Direktorin des DEI Amman und verfasst als Keramik-spezifischen Artikel der Bände 1 und 5-6 für die Grabungsendpublikation.
Andrea Gropp: Die religionsgeschichtliche Entwicklung Nordpalästinas von der Frühen Bronzezeit bis zum Ende der Eisenzeit am Beispiel des Tall Zira’a Ziel der Arbeit ist eine Darstellung der Religionsgeschichte Nordjordaniens auf Basis der archäologischen Hinterlassenschaften am Beispiel des Tall Zira’a. Aus allen Epochen stammen kultisch-religiöse Funde und Befunde, die fast ausnahmslos exakt stratifiziert und entsprechend gut datiert sind. Daher bietet sich hier die Möglichkeit, neben den auf die einzelnen Epochen bezogenen Aussagen zum kultischen Geschehen auch die Entwicklung des Kults auf dem Tall nachzuvollziehen. Als für die Arbeit relevante Funde und Befunde werden all diejenigen Objekte, die Rückschlüsse auf religiöse Praktiken oder Vorstellungen zulassen, verstanden. Diese werden beschrieben, mit Vergleichsstücken in Beziehung gesetzt und im Rahmen ihres kulturgeschichtlichen Kontextes interpretiert. Volltext online: http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DocumentServlet?id=3961 urn:nbn:de:hbz:468-20140528-100557-5 Fachbereich A Geistes- und Kulturwissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal Doktorvater: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. D. Vieweger, 14. Februar 2014.
Dr. Andrea Gropp hat von 2003 bis 2013 an unseren Ausgrabungskampagnen in Jordanien und im BAI mitgearbeitet.

Markus Heyneck: Gilead – Eine biblisch-archäologische Konstruktion der Eisenzeit Nordjordaniens (1200-520/450 v. Chr.) In dieser Arbeit wird eine biblisch-archäologische Konstruktion der Eisenzeit Nordjordaniens/ Gileads (ca. 1200–520/450 v. Chr.) vorgenommen. Dabei besteht das Ziel in einer systematischen Darstellung und Auswertung des aktuellen, in den letzten 15 Jahren stark vorangeschrittenen Forschungsstandes. Volltext online: http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/edocs/dokumente/fba/evtheologie/diss2012/heyneck Doktorvater und Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. D. Vieweger Zweitgutachter: Prof. Dr. A. Eich Das Rigorosum fand am 06.03.2013 im Biblisch-Archäologischen Institut Wuppertal statt. Den Prüfungsausschuss bildeten Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. D. Vieweger, Prof. Dr. A. Eich, Prof. Dr. P. Mommer und Prof. Dr. K. Erlemann.
Dr. Markus Heyneck war wissenschaftlicher Assistent am BAI von Oktober 2002 bis März 2008.